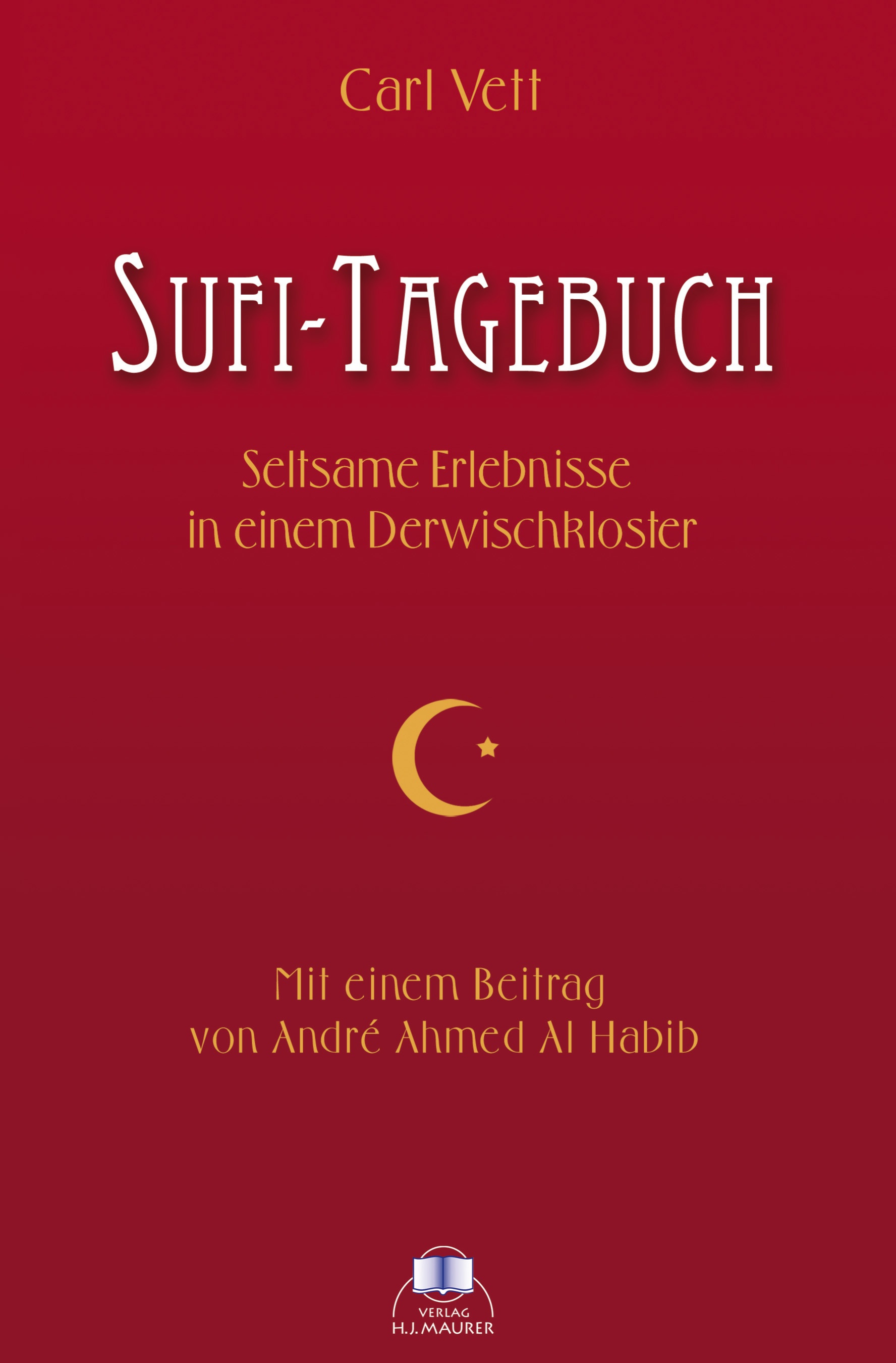Copyright 2005 Verlag Hans-Jürgen Maurer
Vorwort
Kapitel I Eine wertvolle türkische Bekanntschaft
Kapitel II Dunkle Seitenwege der islamischen Mystik
Kapitel III Besuch in einem Mevlevi-Tekké der »Tanzenden Derwische«
Kapitel IV Besuch in einem Rufai-Tekké der »Heulenden Derwische«
Kapitel V. Östliche und westliche Mystik
Kapitel VI Erwägungen vor dem Eintritt in ein Tekké
Kapitel VII Aufnahmeprüfungen
Kapitel VIII Besuch beim Scheich Essad Efendi
Kapitel IX Tagebuch aus dem Tekké
Erster Tag im Tekké
Ankunft – Besichtigung und Eindrücke
Zweiter Tag im Tekké
Einführung in das Klosterleben – Meine Gefährten
Dritter Tag im Tekké
Kalifen zu Besuch
Vierter Tag im Tekké
Erste Teilnahme beim Zikr
Fünfter Tag im Tekké
Weitere Zikrs und Besucher
Sechster Tag im Tekké
Der Übersetzer – Mein erster Führer in Stambul
Siebter Tag im Tekké
Lebendige Nacht – Leben und Tod im Islam
Achter Tag im Tekké
Esoterik
Neunter Tag im Tekké
Dschinnen – Träume – Beziehung zu den Toten – Reinkarnation
Zehnter Tag im Tekké
Musik – Ost und West – Bücher – Empfehlungsschreiben
Elfter Tag im Tekké
Freitagsgebet – Besuch der drei Professoren – Okkulte Evolution
Zwölfter Tag im Tekké
Hizir – Korangesang – Reinkarnation – Einweihung – Propheten
Dreizehnter Tag im Tekké
Koran – Ekstase – Islamische Orden – Phänomene – Teilnahme an den
Gebeten
Vierzehnter Tag im Tekké
Fragen – Abschied – Der Brief des Scheichs
Kapitel X Besuch bei Ali in Üsküdar
Kapitel XI Kleinasiatische Gartenparty mit den später zum Tode
verurteilten Scheichs
Kapitel XII Besuch bei einem ägyptischen Pascha und seiner
hellsichtigen Frau
Post festum
Anthroposophie und Sufismus
Eine Betrachtung von André Ahmed Al Habib 234
Verzeichnis der Abbildungen:
Der ehrenwerte Bey
Die »Tanzenden Derwische«
Scheich Essad Efendi
Eingang zum Tekké
Islamische Grabstätten
Tägliche Meditation im Tekké
Der Übersetzer, Ali, der Scheich, der Autor
Der Autor im Tekké
Frauen auf dem Weg zum Tekké
Scheich Essad Efendi auf dem Heimweg
Besucher im Bedewi-Tekké
Der Friedhof zu Üsküdar
Zwei leitende Scheichs aus Stambul
Der Brief des Scheichs
Vorwort
Vor etwa sieben Jahren lebte ich in Konstantinopel und erlangte 1925 nach dem, was allgemein gesagt wurde, als erster Nichtmuslim die Erlaubnis, in einem Tekké – und zwar der Naqshbandi-Derwische – eine Zeitlang als Ordensbruder zu leben. Durch vieljährige Studien waren mir die Phänomene der Parapsychologie bekannt; so lag mir daran, die ekstatischen Zustände der Derwische unter den Initiationsvorgängen zu studieren, denn die Geheimorden des Islam sind Initiationsschulen.
Während und vor diesem Aufenthalt wurde ein Tagebuch geführt, das eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber nach den letzten traurigen Ereignissen in der Türkei, wo vor kurzem (im Februar 1931) in Menemen 29 Todesurteile vollstreckt wurden, hauptsächlich unter Angehörigen des genannten Ordens, von denen damals einige mit dem Verfasser – unter Führerschaft des alten Scheichs Essad – im Kloster lebten, meint er, daß seine damaligen Erfahrungen auch für weitere Kreise von Interesse sein könnten, und hat sich deshalb für eine Veröffentlichung entschieden.
Es muß in Betracht gezogen werden, daß die folgenden Schilderungen einer bereits verschwundenen Zeit angehören. Damals waren die Angehörigen des Sufiordens leitende Persönlichkeiten in der Türkei. Hohe Beamte, Universitätslehrer, Militärs und reiche Kaufleute nahmen mit dem Volk teil an den Übungen der sogenannten »Tanzenden Derwische« oder der »Heulenden Derwische« oder zogen sich während der Fastenzeiten in die Tekkés zurück, wo sie ihre Gebete und Meditationen in Ruhe ausüben konnten. Die Sultane gehörten gewöhnlich sogar irgendeinem Orden an und bedachten denselben mit reichen Gaben. In vielen Tekkés waren die Ausschmückungen der Räume von außerordentlicher Schönheit und die »Türbes« oder Sarkophage der früheren Meister Marmorarbeiten bedeutender Künstler.
Heute sind dort alle Tekkés oder Derwischklöster geschlossen, die Orden aufgehoben und die früher so malerischen Sufigewänder und eigenartigen, für jeden Orden verschiedenen, Kopfbedeckungen verschwunden.
Die moderne Türkei hat nur ein Mitleidslächeln für diese Ausschläge des früheren »Aberglaubens« und der »Kindereien« übrig. Aber eine Quelle des reinen Wissens durch meditative Versenkung in die Gottheit hat aufgehört zu fließen. Dieselbe Quelle, aus der die Impulse zu den schönsten und größten Werken, auch in der christlichen Kultur, geschöpft sind, mit denen frühere Kulturen des Ostens die Menschheit bereichert haben.
Eine solche radikale Abrechnung mit der Vergangenheit, wie sie von der heutigen Regierung der Türkei durchgeführt wurde, mag in der historischen Entwicklung notwendig sein und kann in allen Einzelheiten mit der Reformation des Christentums verglichen werden. Aber eine wehmütige Erinnerung an die Schönheiten der Vergangenheit kann in einem Volk von all den hohen und guten Eigenschaften, wie sie das türkische besitzt, nur zu höherer Selbstachtung und stärkerem Einheitsgefühl führen.
Da ich von meinem Klosteraufenthalt und von den Menschen, mit denen ich dort in Verbindung kam, die angenehmsten Erinnerungen habe, ist dieses Buch in dankbarer Erinnerung an den zum Tode verurteilten türkischen Scheich des Naqshbandi-Ordens Essad Efendi und seinen in Menemen am 3. Februar 1931 hingerichteten Sohn Mehmet Ali Efendi niedergeschrieben.
Mai 1931
CARL VETT
Kapitel I
Eine wertvolle türkische Bekanntschaft
Ein orientalischer Bey, der die höchsten Ämter seines Landes bekleidet und als Botschafter viele Jahre in Europa gelebt hat, also westliche und östliche Bildung in sich vereinigt, geht unter die Derwische und macht sich ihre Lehren zu eigen, ohne allerdings das Sufigewand anzulegen. Wohlverstanden, der Bey steht noch immer auf der Höhe des Lebens. Ein solcher Wechsel in seinem Alter und nach einer so glänzenden Laufbahn erscheint uns Europäern beinahe unverständlich. Im Osten ist das fast etwas Alltägliches und bedeutet keine Sensation.
Das Schicksal führte uns beide zusammen. Gemeinsame Interessen und Lebensanschauungen verbinden uns bis heute. Die Gesetze des Karmas, die die Wege der Menschen leiten, führten mich durch ihn in das islamitische Tarikaat ein. Hier fand ich die Kontinuität uralter Kulturen, die ich in Europa vergeblich gesucht hatte.
Ich hatte meinem Freund, dem Bey, einen Teil der geisteswissenschaftlichen Schriften, die sich mit parapsychologischen Studien beschäftigen, zu lesen gegeben, und er hat sofort verstanden, daß mit ihnen eine Grundlage vorhanden ist, die eine Vereinigung von Osten und Westen möglich macht.
In unserem Gedankenaustausch über dieses Thema sprach ich, soweit es den Osten betraf, in der Regel wie der Blinde von der Farbe, da ich nur eine ganz oberflächliche Anschauung von der modernen orientalischen Gedankenrichtung hatte. Und was die Religion betrifft – sie ist im Osten wesentlich –, so urteilte ich nach dem, was mir im äußeren Kult begegnete. Ich sagte einmal, die Religion habe hier wie im Westen ihren lebendigen Gehalt verloren und sei zu toten Formen und Dogmen erstarrt. Mein türkischer Freund widersprach und behauptete, das Schariaat (die exoterische) und das Tarikaat (die esoterische Religionsausübung) seien wie Tag und Nacht verschieden. Ein Fremder, der niemals das Tarikaat (Sufismus) und den mannigfaltigen Okkultismus der Derwischorden kennengelernt habe, wisse nicht, was sich in der Welt des Islam rühre. Ungeachtet der Nationalität und Rasse würden etwa 275 Millionen Muslime in unverbrüchlicher religiöser Einigkeit zusammengehalten. Unter den primitiven Völkern mache der Islam auch ohne Propaganda, weit schnellere Fortschritte als das Christentum mit seiner Mission.
»Die Lehren des Schariaat«, so äußerte sich mein Freund weiter, »die von allen Rechtgläubigen als heilig und unveränderlich betrachtet werden, sind in der vor sich gehenden Reformation und notwendigen politischen Umwälzung etwas in den Hintergrund gedrängt worden und werden stets mehr an Boden verlieren. Einer meiner Freunde sprach vor vielen Jahren mit dem geistigen Leiter der Muslime in Bulgarien und beklagte sich über den wachsenden Unglauben und den Bruch mit den Traditionen des Schariaats. Da antwortete ihm jener Leiter, in nicht allzu langer Zeit würde das heilige Ritual, das der Prophet selber vorgeschrieben habe, mehr oder weniger verschwinden. Und der äußere Kult müßte dann seine Form in dem Maße verändern, daß er kaum mehr zu erkennen wäre. – Sie sehen, nachher kam Krieg, Revolution, Republik und schließlich die Abschaffung des Kalifats.«
Einem Freund, der kürzlich aus Ankara nach Stambul zurückgekehrt ist, wurde von einer tonangebenden Persönlichkeit der Regierung folgendes gesagt: »Die Türken haben mit diesem Jahr ihren letzten Fastenmonat (Ramadan) erlebt. Das Fasten wird verschwinden, da es das Volk nur faul und schlaff macht. Und in drei Jahren dürfte selbst der Fes eine Seltenheit sein, trotzdem er bisher als das Zeichen des rechtgläubigen Türken galt.«
Indem ich dieses niederschreibe, fällt mir folgender Ausspruch eines alten Scheichs ein: »Alles, was geschieht, liegt in Allahs Hand und hat einen tieferen Zusammenhang, als wir Menschen ahnen! Die äußere, tote Form des Schariaats wird vergehen. Das innere Leben muß dem äußeren neue Prägung geben. Es gilt, die verborgenen Schätze des Tarikaats in den Tekkés zu heben und zum Gemeingut zu machen, damit diese Kräfte in die Zukunftsentwicklung einfließen können!«
…
Kapitel VIII
Besuch beim Scheich Essad Efendi
Am betreffenden Tag begeben wir uns, um ihm unsere Aufwartung zu machen, zum Tekké des Meisters des Beys. Wir kommen unterwegs an einer Moschee vorbei, wo seine Vorfahren beigesetzt sind. Hier will der Bey sein Gebet abhalten. Der Türbedar, das heißt der Aufseher, der die Grüfte der Sultane und Heiligen zu betreuen hat (ein hohes Vertrauensamt), ist ein Freund von ihm. Wir besuchen das Mausoleum eines Groß-Sultans, wo man durch eine Glaswand auf die mächtigen, turbangeschmückten Sarkophage des Sultans und der heiligen Männer blickt. Die kleineren, unscheinbareren im Hintergrund gehören ihren Frauen und minderjährigen Kindern, die, wie im Leben, auch hier zurücktreten müssen. Mein Begleiter stellt mich dem Türbedar als einen Adepten vor, der im Begriff sei, sich »zum rechten Glauben« zu bekehren. Mit offenen Armen begrüßt mich dieser feine, sympathische Mann und heißt mich im Islam willkommen. Er ist nach Aussage meines Freundes einer der am höchsten entwickelten Scheichs in dieser Stadt und hat als Schüler und Nachfolger eines der großen Meister im Amte des Türbedar die Hoffnung, dessen würdiger Erbträger zu werden. Dieser starb vor 5 Jahren, nachdem unser Freund 30 Jahre hindurch als Adept in seinem Dienst gestanden hatte. Er soll ein vollkommener Heiliger gewesen sein, einer von denen, die der Prophet mit den Worten gekennzeichnet hat: »Ein Gottesbote kann immer durch sein strahlendes Angesicht, das die Gedanken eines jeden, der es sieht, zu Gott führt, erkannt werden.« Der Türbedar hat seinen Vertrauten erzählt, daß es oft, während er kniend in stiller Andacht vor dem Meister saß, vorgekommen sei, daß dessen irdische Gestalt sich in einen Strahlenglanz auflöste und verschwand. Er saß dann ganz still konzentriert und dankte Gott für einen so erhabenen Lehrer. Nach kürzerer oder längerer Zeit, doch selten nach mehr als einer halben Stunde, saß der Meister wieder vor ihm in seiner irdischen Erscheinung.
Ich erkundigte mich später bei vielen Menschen, die diesen Meister, Ahmed Efendi, gekannt hatten, über ihn, und alle versicherten, seine Person habe einen heiligen Glanz ausgestrahlt. Nur mit größter Ehrfurcht näherte man sich ihm.
Sein Schüler hat ein herzgewinnendes Lächeln, und ich fühle in mir bald ein merkwürdiges inneres Verständnis von seinem Wesen. Die Worte, die wir wechseln, gehören verschiedenen Sprachen an. Durch diese verstehen wir einander nicht. Doch die Sprache der Herzen gibt ein tieferes Verständnis.
Er liest meine Gedanken und läßt mir durch den Bey sagen: »Hier sind viele Gelehrte aus Europa gewesen, um den Islam zu studieren. Sie kannten unsere Sprache und unsere Literatur und haben dicke Bände über uns geschrieben. Aber ein wirkliches Verständnis für uns haben sie nicht besessen. Dazu wird dasjenige Herzensverständnis gefordert, das auf anderem Wege als durch die gewöhnliche Intelligenz zu erwerben ist. Bei uns unterscheiden wir zwischen Gelehrten und Weisen. Die letzteren können, was Gelehrsamkeit angeht, ganz unwissend sein, aber sie dringen in der Regel tiefer in die Wahrheit ein als die ersteren. Ich fühle bei dir etwas von diesem Herzensverständnis, das mir bei den anderen Europäern, die mich besuchten, nicht entgegengetreten ist. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Vorhaben, das sicher reiche Früchte tragen wird.« Er fordert mich auf, ihn öfters zu besuchen. »Wenn wir auch nicht zusammen sprechen können«, sagt er, »so kann ich dir auf andere Art helfen.« – Später erfuhr ich, daß er eine große Anzahl Schüler hat, die ihn zu bestimmten Zeiten besuchen und ständig in okkulter Beziehung zu ihm stehen.
Nach diesem Besuch setzen wir unseren Weg zum Tekké fort, das bald meine neue Wohnstätte sein soll. Sein Leiter, ein ehrwürdiger achtzigjähriger Greis, empfängt uns auf das Herzlichste und drückt seine Freude über meinen Entschluß aus, indem er zugleich verspricht, mir so gut wie möglich beistehen zu wollen. Ein anderer Besucher ist eben im Begriff, sich zu verabschieden: ein außergewöhnlich eleganter Orientale mit vollendeten Manieren, übrigens der erste mit blauen Augen und blondem Haar, dem ich begegne. Er wird als Verwalter der Stammtafel der Nachkommen des Propheten vorgestellt. »Eines der wichtigsten Ämter!« flüstert mein Begleiter. Nun wendet der Scheich mir seine Aufmerksamkeit zu. »Wir wirken hier bei uns mehr von Herz zu Herz als durch Worte«, sagt er. »Alles Äußere überlassen wir dem einzelnen. Hier kann jeder schlafen, essen und reden, so viel oder so wenig es ihm beliebt. Setze dich nach unserer Art auf diesen Diwan, damit wir versuchen können, wie es sich mit dem Kontakt unserer Herzen verhält.« Ich nehme mit gekreuzten Beinen ihm gegenüber auf demselben Diwan Platz und knöpfe meine Jacke auf, so daß das Herz freier liegt. Er lächelt und sagt: »Unser großer Meister und Reformator Al-Ghazzali sagte, daß das, mit dem sich der Mensch Gott nähere, nicht der Körper sei, sondern das Herz! Unter Herz verstand er zwar etwas anderes als das Stück Fleisch, das man heute gewöhnlich so benennt. Etwas mit den Sinnen nicht zu Erfassendes, das zu dem großen Geheimnis gehört, das uns den Weg zu Gott weist. Konzentriere dich jetzt darauf, dieses, dein übersinnliches Herz in Verbindung mit meinem zu bringen.«
Ich schließe die Augen und mache eine Willensanstrengung in dieser Richtung. Lange sitzen wir so einander gegenüber. Ich erwache aus meiner Abwesenheit, als der Scheich auf mich »haucht«, und ich glaube, dies sei ein Zeichen zum Ende dieses Sitzens. Er macht beruhigende Gesten mit der Hand, die andeuten, daß wir mit dieser Übung fortfahren sollen. Wir sitzen uns wohl 20 Minuten gegenüber und viermal werde ich angehaucht. Die Glieder schmerzen von der ungewohnten Stellung. Endlich winkt er den Dolmetscher heran und fragt mich durch ihn, was ich gespürt habe. – »Nur eine tiefe innere Ruhe und wohltuenden Frieden habe ich in meinem Inneren gefühlt.« – »Hast du die Empfindung von irgendwelchen Farben gehabt?« Ich muß das verneinen. »Ich fühlte, wie ein grünliches* Licht von deinem Herzen ausging!« sagt er und scheint mit der Probe zufrieden zu sein. Nachdem wir uns noch eine kurze Zeit unterhalten haben, zeigt er mir das Zimmer, das ich beziehen werde. Es stößt an den Empfangsraum, der mit eingerahmten Sprüchen aus dem Koran geschmückt ist. Mit herzlichem Lächeln werde ich verabschiedet. Am nächsten Morgen kann ich eintreten.
»Sehr gut bestanden«, sagt der Bey beim Gehen, »es scheint fast, als hätten Sie das Interesse des Alten gewonnen. Es ist sehr schwer, in ein besonderes Verhältnis zu ihm zu kommen, das heißt in eines, das sich von dem seinen anderen Schülern gegenüber unterscheidet. Aber zu Ihnen war er offener, als es sonst seine Art ist. Ich hatte ihn zwei Jahre lang meine okkulte Entwicklung leiten lassen, ehe er mich einen Eindruck von seiner wirklichen Größe bekommen ließ. Darum freut es mich, daß er Ihr Wegweiser zum Islam sein wird und nicht Küçük Osman. Dieser hat zwar Initiative und Energie in Fülle und konnte mehr als einmal in die Tagesereignisse eingreifen. Darum meinte ich, er könnte Ihren Bestrebungen am meisten dienlich sein. Mein Orden aber wird Ihnen sicherlich mehr zusagen als der andere, der so viel Wert auf alles Äußere legt. Welchen Eindruck hätte es wohl auf Sie gemacht, wenn der kleine Meister Ihnen als Übung vorgeschrieben hätte, den Namen Allahs 5000mal am Tage laut zu nennen und sonst nichts zu tun – was für den Anfänger eine der häufigsten Übungen ist? Bei uns handelt es sich mehr um eine Vertiefung in sich selbst und um einen gewissen Herzenskontakt mit unserem Meister, wodurch die moralische Entwicklung gefördert wird. Alle Äußerlichkeiten werden abgestreift. Sie müssen morgen, wenn Sie antreten, Ihren Dolmetscher mitbringen und ihn mit dem Scheich abmachen lassen, wie oft dieser seine Gegenwart wünscht.« Ich verstand, daß es eine Probe war, auf die er mich gestellt hatte, als wir zum ersten Tekké fuhren. Erst nachdem er gesehen hatte, daß es mir wirklich ernst war und daß ich mich entschließen konnte, auf alle Bequemlichkeiten des modernen Lebens zu verzichten, um eine geistige Schulung durchzumachen, ließ er mich in seinen eigenen Orden ein.
…
Kapitel IX
Tagebuch aus dem Tekké
Erster Tag im Tekké
Ankunft – Besichtigung und Eindrücke
Am nächsten Tag zur Mittagszeit kommen der Dolmetscher und ich im Tekké, das inmitten eines Pompeji von Ruinen in Stambul liegt, an. Zwischen alten Holzhäusern steht das Tekké, auch aus Holz gebaut und von weitem schon kenntlich durch seine hohen Zypressen, die über die niedrigen Häuser der Umgebung emporragen. In der Mauer, die das Gebäude umschließt, ist ein großes Holztor. Wir klopfen an, und hilfsbereite, etwas behäbige Männer mit dunklen Augen und mildem Blick sind uns bei dem Hereinschaffen meines einfachen Gepäcks behilflich. Es besteht aus einem zusammenschiebbaren Feldbett nebst Wolldecke, Klappstuhl und einer kleinen Handtasche. Wir lassen die Schuhe, wie üblich, beim Eingang zum Tekké stehen und steigen eine Holztreppe empor, die auf einen mit Kelims belegten Vorsaal mündet. Hier habe ich Zeit, mich näher umzuschauen. Durch zwei holzvergitterte Fenster blickt man in den Tekké-Saal hinunter. Von hier aus wohnen die Frauen ungesehen den Gottesdiensten bei. Vom Vorsaal aus gelangt man in zwei nebeneinanderliegende Zimmer. Eines ist der Empfangsraum des Scheichs, das zweite wird mir angewiesen.
Es liegt nach Norden und ist groß und luftig, aber nicht rein. Auf dem Boden sind Kelims ausgebreitet. In die Wand, die an das Zimmer des Scheichs stößt, sind große vorstehende Wandschränke eingelassen, auf denen staubige arabische Bücher aufgehäuft liegen. Die zwei anderen Wände haben Fenster, die vierte ist ein dünner durchlöcherter Bretterverschlag nach dem Vorsaal hin. Längs den Wänden liegen baumwollbezogene Matratzen. Eine zerrissene braune Tapete mit weißen Blumen als Muster deckt zum Teil die Wände, deren schwarzer Anstrich hier und da zum Vorschein kommt. Die Decke besteht aus dunkelbraun gemaltem Holz. Es bläst ein kalter Nordwind. Die Fenster klappern, Tapetenfetzen flattern im Luftzug, Spinnweben schaukeln in allen Ecken, und ab und zu erhebt sich eine kleine Staubwolke von den arabischen Folianten. Wie gut, daß ich ein Moskitonetz mitgebracht habe, denn hier scheint ein Eldorado für Parasiten zu sein.
Aus den Rissen in den Wänden, vom Holzplafond, von Matratzen und Kelims ist in der Nacht ein Heer von blutsaugenden Wesen zu erwarten. Häuslich sieht es hier nicht aus, doch die Sonne scheint draußen. Zwischen den Ruinen blicke ich auf schlanke Minarette, in Grün gebettet, und jenseits des Marmarameeres tauchen die blauen Berge Kleinasiens auf.
Jetzt kommt der Scheich langsam die knarrende Treppe herauf, um mich willkommen zu heißen. Er läßt sich mit gekreuzten Beinen nieder, ganz in die Falten seines langen Mantels eingehüllt, und weist mir gütig einen Platz neben sich an. Er macht einen ehrwürdigen Eindruck mit seinem langen weißen Bart, dem gefurchten Gesicht und den schwarzen, lebendigen, milden Augen, die viel jünger aussehen als seine achtzig Jahre. Nachdem wir uns gesetzt haben, werden die üblichen Begrüßungen gewechselt. Er sagt, daß ich mich im Tekké ganz zu Hause fühlen soll. Es habe eine gute Küche, ich könne alles haben, was ich wolle, wenn ich es ihm nur sagte. Ob ich Eier äße? Sie hart oder weich vorziehe? Ob Butter und Honig mir schmecken? Wie es mit Lammbraten stünde oder Yoghurt?
Nachdem wir das Materielle besprochen haben, geht er zum Spirituellen über, indem er fragt: »Glaubst du an Gott? Glaubst du, daß Gott überall anwesend und alles sehend ist?« Ich antworte, daß ich in all dem Leben der Natur, in Pflanzen, Tieren und Menschen eine Offenbarung der göttlichen Kräfte sähe, als Beweis der Existenz Gottes. Die Antwort scheint ihm zu gefallen.
»Wie empfindest du einem König oder Kaiser gegenüber?« fragt er weiter. »Das hängt ganz von seinen menschlichen Eigenschaften ab«, antworte ich. »Ist er ein hochentwickelter, edler Mensch, so habe ich Achtung und Ehrfurcht vor ihm. Ist er dies nicht, so schätze ich ihn nicht höher als andere Menschen. Seine Titel machen keinen Eindruck auf mich. Ich kann mehr Achtung vor einem Bettler haben, der als Mensch groß ist, als vor einem König oder Kaiser, der auf einer tieferen Stufe steht.« Der Scheich ist mit dieser Antwort nicht zufrieden, denn der Untertanenglaube erscheint dem Orientalen als etwas Selbstverständliches. In den Herrschern dieser Welt sieht er Auserwählte Gottes. Sind diese als Menschen unvollkommen, so hat Gott auch dafür seine guten Gründe. Minderwertige Herrscher werden zur Strafe von Gott über ein Volk gesetzt. Ich verstehe seine Gedanken, füge aber zu seiner Aufklärung hinzu: »Im Westen sind Begegnungen mit Königen, und besonders mit abgesetzten Königen, ein alltägliches Phänomen. Ich habe öfters Gelegenheit gehabt, mit solchen, ja sogar mit ein paar Kaisern zu sprechen, ohne daß ihre menschlichen Eigenschaften besonderen Eindruck auf mich machten.«
Der Scheich läßt nun seine erste Frage fallen und sagt nur: »Die Ehrerbietung des Untertanen mußt du immer auf Gott mit übertragen; bedenke, daß er stets anwesend ist. Alle deine Taten und Gedanken müssen von der Einsicht gelenkt sein: ›Ich stehe meinem Kaiser gegenüber!‹«
Der Scheich verläßt mich, um bei seiner Familie, die ein an das Tekké grenzendes Haus bewohnt, zu essen. Ein Tablett wird hereingebracht mit Tellern, Bestecken und reinen Servietten, ganz nach europäischer Art. Weichgekochte Eier werden serviert nebst Brot und Honig. Alles schmeckt vorzüglich.